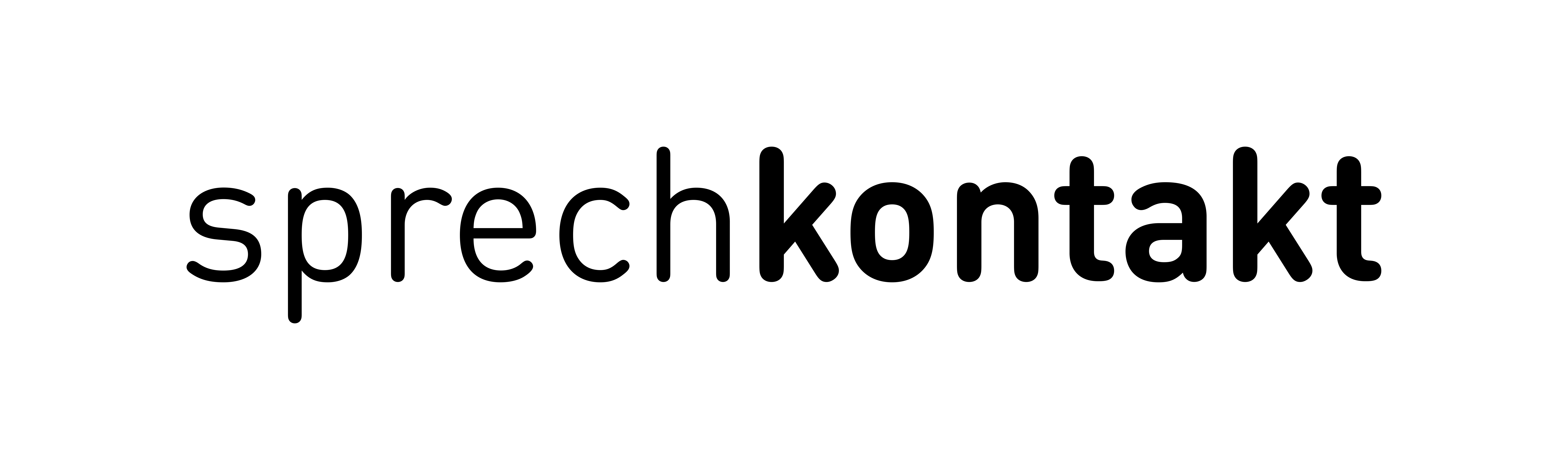12. Mar 2025 | Physikalische Soiree, Podcastepisode
Zu Gast: Stefan Reithofer
In dieser Episode der Physikalischen Soiree, Nr. 255, diskutiere ich mit meinem Gast Stefan über die faszinierende Welt der Paludarien. Diese einzigartigen Systeme kombinieren Aspekte von Aquarien und Terrarien und ermöglichen es uns, eine vielfältige Umgebung zu schaffen, die sowohl Wasser als auch Land umfasst. Als Tierpfleger und Aquaristik-Enthusiast bringt Stefan wertvolle Expertise über die Tiere mit, die in diesen besonderen Lebensräumen gedeihen können.
Wir beginnen mit einer detaillierten Erklärung, was ein Paludarium ausmacht. Stefan beschreibt es als Nachbildung eines Sumpfgebiets, das sowohl Wasser- als auch Landbereiche bietet. Dabei erforschen wir die verschiedenen Arten von Aquaterrarien, darunter Rivarium und Riparium, und unterhalten uns über die korrekte Terminologie, die oft in der Aquaristik verwendet wird. Außerdem werfen wir einen Blick auf Wabikusa, eine besondere Kunstform, die mit Wasserpflanzen arbeitet, die sowohl unter Wasser als auch über Wasser gedeihen.
Ein zentrales Thema dieser Episode ist die Freude und Herausforderung, sich ein Paludarium zu Hause zu schaffen. Wir sprechen über die nötigen Überlegungen bei der Einrichtung, wie Licht, Temperatur und Feuchtigkeit, und die Geduld, die erforderlich ist, um ein funktionierendes und gesundes Ökosystem zu entwickeln. Stefan betont die Wichtigkeit der Vorbereitungen und der langfristigen Planung, um das Gleichgewicht im Paludarium zu wahren.
Im Laufe unserer Unterhaltung beleuchten wir Einstellungen und Strategien zur Tierhaltung in Paludarien. Stefan erläutert, welche Tierarten, wie bestimmte Fische und Amphibien, sich in diesen Lebensräumen wohlfühlen und welche Bedingungen nötig sind, um diese Tiere artgerecht zu halten. Dabei gehe ich auf meine eigenen Erfahrungen ein und beschreibe die Biotope, die ich derzeit pflege, um den Zuhörern ein praktisches Verständnis für die Materie zu vermitteln.
Ein weiterer interessanter Aspekt sind die symbiotischen Beziehungen zwischen den verschiedenen Lebensformen im Paludarium. Dies umfasst die Interaktionen zwischen Fischen und Pflanzen sowie zwischen Tieren, die in diesen komplexen Mini-Ökosystemen leben. Unsere Gespräche fördern ein tieferes Verständnis für die Herausforderungen und Freuden, die mit dem Betrieb eines Paludariums verbunden sind.
Die Episode schließt mit dem Gedanken, dass Natur, egal in welchem Maßstab, eine dynamische Plattform für Beobachtungen und Lernprozesse bietet. Stefan unterstreicht die Bedeutung der Geduld und des kontinuierlichen Lernens, wenn man mit lebenden Systemen arbeitet. Seine abschließenden Worte ermutigen dazu, die Natur zu schätzen und die Schönheit und Komplexität der Ökosysteme zu erkennen, die wir zu uns nach Hause bringen können.
Foto: Stefan Reithofer
Diese Episode ist am 12.03.2025 erschienen. Dauer: 0
Stunden
30
Minuten
und 27
Sekunden

4. Mar 2025 | Fotos, Tagebuch


3. Mar 2025 | Physikalische Soiree, Podcastepisode
Im Interview spricht Lothar mit Ingeborg Lang, einer Biologin am Department für Funktionelle und Evolutionäre Ökologie der Universität Wien, über ihre Forschung an Pflanzenzellen, insbesondere über Moose. Ingeborg erklärt, dass ihre Studien im Bereich der Ökologie und Zellbiologie angesiedelt sind, mit einem speziellen Interesse daran, wie Pflanzenzellen unter unterschiedlichen Feuchtigkeitsbedingungen reagieren. Sie diskutiert die physikalischen Veränderungen, die in Zellen und Blättern auftreten, wenn Pflanzen austrocknen oder ausreichend Wasser haben.
Moose werden als faszinierende Forschungsobjekte hervorgehoben, da sie eine einfache Struktur aufweisen und sich leicht mikroskopieren lassen. Ingeborg hebt hervor, dass Moose die ersten Pflanzen sind, die den Übergang vom Wasser an Land vollzogen haben, was sie zu einem wichtigen Element der Evolution macht. Sie erläutert zudem, wie Moose in verschiedenen Lebensräumen wachsen können, von extrem sonnigen Standorten bis hin zu schattigen Bereichen, und dass sie sogar überleben können, wenn sie austrocknen, indem sie ihre Zellen anpassen und wieder wachsen, sobald sie wieder feucht sind.
Die Konversation bewegt sich weiter auf die Anwendbarkeit von Moosen als bioindikatorische Organismen, die helfen können, metallische Kontamination in der Umwelt zu überwachen. Ingeborg beschreibt die Möglichkeiten, wie Moose Schwermetalle aus der Atmosphäre aufnehmen und speichern, was ihnen eine wichtige Rolle als Biomonitore verleiht. Sie führt aus, dass diese Fähigkeit von Bedeutung ist, um Umwelteinflüsse zu verstehen und Maßnahmen gegen Kontaminationen zu ergreifen.
Das Thema Paludarien, die Kombination aus Wasser- und Landlebensräumen, wird weiter vertieft. Lothar erklärt sein persönliches Interesse an einem Paludarium, das er eingerichtet hat, und fragt Ingeborg nach den Herausforderungen und Möglichkeiten bei der Pflege dieser Ökosysteme. Ingeborg betont die Bedeutung von Feuchtigkeit und Licht für das Gedeihen der Pflanzen in einem Paludarium und diskutiert die physiologischen Anforderungen von Moose und anderen Pflanzen, die in solchen Bedingungen gedeihen müssen.
Ein zentraler Punkt des Interviews ist die Diskussion über die Komplexität von Pflanzenzellen und ihren Anpassungen an verschiedene Umwelteinflüsse. Lothar und Ingeborg sprechen über die mechanischen und physikalischen Eigenschaften von Pflanzenzellen und deren Reaktionen auf Stressfaktoren wie Trockenheit und Überfeuchtung. Es wird erörtert, wie sich der Metabolismus von Pflanzenzellen unter verschiedenen Bedingungen verhält und welche Techniken in der Forschung angewendet werden, um diese Prozesse zu analysieren.
Im weiteren Verlauf wird die Evolution von Pflanzen thematisiert, insbesondere die Entwicklung von mehrzelligen Organismen aus einzelligen Vorfahren und die Rolle von Wasser und anderen Ressourcen bei diesem Übergang. Ingeborg bringt ein, dass viele Pflanzen auch Strategien entwickelt haben, um in feuchten und trockenen Umgebungen zu überleben, und spricht über die Vitalkraft von Moosen, die in vielen Lebensräumen als Pionierpflanzen fungieren.
Das Gespräch schließt mit Überlegungen zur Weitergabe von Wissen und den Unterschieden zwischen akademischer Forschung und Hobbyisten, die sich mit Botanik und Aquaristik beschäftigen. Ingeborg drückt ihre Wertschätzung für die Community von Hobbyisten aus, die oft tiefgehende Kenntnisse über bestimmte Pflanzenarten besitzen. Sie betont, dass der Austausch von Wissen zwischen Wissenschaft und praktischer Anwendung wichtig ist, um das Verständnis von Pflanzen und Ökosystemen zu vertiefen.
Insgesamt bietet das Interview einen tiefen Einblick in die für das Überleben von Pflanzen entscheidenden Faktoren, die Evolution der Flora und die komplexen Wechselwirkungen zwischen Pflanzen, ihrer Umwelt und den Forschungsmethoden, die verwendet werden, um dieses faszinierende Gebiet weiter zu erforschen.
Gesprächspartnerin:
Ao.Prof. Mag. Dr. Ingeborg Lang
Vice Dean (Teaching)
Dept. of Functional and Evolutionary Ecology
Faculty of Life Sciences
https://mosys.univie.ac.at/team/ingeborg-lang/
// Kurzfassung via Auphonic Whisper ASR
Diese Episode ist am 03.03.2025 erschienen. Dauer: 1
Stunde
3
Minuten
und 27
Sekunden

24. Feb 2025 | Physikalische Soiree, Podcastepisode

In der 253. Folge der Physikalischen Soirée stehen fleischfressende Pflanzen und deren speziellen Lebensräume, in denen sie gedeihen, im Mittelpunkt. Lothar Bodingbauer begrüßt als Host der Physikalischen Soiree den Bayer Stefan Krämer, der kreative Paludarien gestaltet – also Lebensräume, die Wasser- und Landzonen miteinander verbinden. Diese kunstvoll arrangierten Biotope sind in Glasbehältern angelegt und bieten den perfekten Lebensraum für verschiedene Arten von fleischfressenden Pflanzen, besonders für den Sonnentau (Drosera), die in sumpfigen Uferbereichen wachsen.
Stefan erklärt, dass sein Interesse an fleischfressenden Pflanzen ursprünglich durch das Sammeln und die Beobachtung dieser Pflanzen in der Natur geweckt wurde. Er stellt fest, dass viele Hobbyisten dazu neigen, die Pflanzen in herkömmlichen Plastiktöpfen zu kultivieren, was jedoch wenig ästhetisch ist. Durch seine Faszination für die natürlichen Lebensräume dieser Pflanzen entwickelte er den Anreiz, seine eigenen Paludarien zu gestalten, um die Schönheit dieser Pflanzen zu zeigen und ihnen eine geeignete Umgebung zu bieten, die ihren natürlichen Bedingungen ähnelt.
Ein zentrales Thema des Gesprächs sind die Grundlagen der Haltung von Karnivoren. Stefan erläutert die Schlüsselfaktoren wie Wasserqualität, Lichtverhältnisse und die Notwendigkeit, die spezifischen Bedürfnisse der Pflanzen zu verstehen. Er hebt hervor, dass viele Menschen fälschlicherweise glauben, dass fleischfressende Pflanzen eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit benötigen, was in den meisten Fällen nicht der Realität entspricht. Viele Arten, wie der südafrikanische Sonnentau, sind robust und können in normalen Wohnbedingungen gedeihen, solange das Substrat ausreichend feucht gehalten wird.
Weiterhin diskutieren Lothar und Stefan die Herkunft der Pflanzen und deren Ansprüche an das Substrat. Während viele denken, dass alle fleischfressenden Pflanzen in tropischen Regenwäldern angesiedelt sind, erklärt Stefan, dass die meisten tatsächlich in weniger feuchten, subtropischen Bedingungen vorkommen. Er beschreibt, dass Sonnentauarten oft in der Nähe von Bächen in südlichen Regionen Afrikas zu finden sind, wo sie unter einem sich wandelnden klimatischen Umfeld gedeihen. Diese Erkenntnisse verdeutlichen, dass das Pflegen von fleischfressenden Pflanzen nicht so komplex sein muss, wie oft angenommen wird.
Stefan erzählt von seinen Erfahrungen, wie er mit der Gestaltung von Paludarien beginnt, indem er sich von Fotos der natürlichen Lebensräume inspirieren lässt. Er betont die Bedeutung des Hardscapes – der Verwendung von Steinen und Holz, um die gewünschten Landschaftsformen zu schaffen. Dabei geht es ihm nicht nur um die nachgeahmten Lebensräume, sondern auch um die künstlerische Komponente, das Design und die Ästhetik in der Gestaltung.
Die Unterhaltung führt zu technischer Ausstattung und Pflanzenpflege. Stefan erklärt, dass künstliche Beleuchtungen ein entscheidendes Element sind, insbesondere wenn natürliche Lichtverhältnisse in einer Wohnung nicht ausreichen. Er gibt praktische Tipps zu Pflanzenlampen und erörtert den Einsatz von kalkfreiem Wasser, um die optimale Gesundheit seiner Pflanzen zu gewährleisten. Hierbei spricht er auch die Herausforderungen an, die sich bei der Wasserqualität ergeben können, und klärt, dass Osmosewasser die beste Auswahl ist, um die Pflanzen vor schädlichen Mineralien zu schützen.
Im Verlauf des Gesprächs wird deutlich, dass die Pflege von fleischfressenden Pflanzen eine persönliche und kreative Ausdrucksform ist, die Gemeinschaft und Austausch fördert. Stefan berichtet, wie seine Arbeit auf Instagram, unter dem Account estebalius-plantedscapes, eine große Anhängerschaft gefunden hat und das Interesse an fleischfressenden Pflanzen und Paludarien gestärkt hat. Er beschreibt die wachsenden Gemeinschaften, die um dieses Hobby entstanden sind, und die positive Rückmeldung, die er erhält, wenn andere von seinem Konzept begeistert sind.
Stefan betont, dass er keine kommerziellen Ambitionen verfolgt und das Ganze als privates Hobby sieht, wobei ihn der Austausch mit Gleichgesinnten und die eigene kreative Entfaltung im Mittelepunkt seiner Aktivitäten stehen. Am Ende der Episode reflektiert Lothar über die thematischen Aspekte des naturverbundenen Designs in einem urbanen Umfeld und die Ästhetik, die die visuelle Gestaltung von Paludarien und Aquascaping begleiten. Die Sendung schließt mit einer positiven Note über die Freude an Pflanzen und die kunstvolle Gestaltung von Lebensräumen – und lädt die Zuhörer ein, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen.
Link: https://www.instagram.com/estebalius_plantedscapes/
Foto von Théotim THORON auf Unsplash
Text automatisiert erstellt via Auphonic Whisper ASR
Diese Episode ist am 24.02.2025 erschienen. Dauer: 1
Stunde
3
Minuten
und 34
Sekunden

10. Feb 2025 | ORF, Österreich 1, Premium, Radioproduktion, Vom Leben der Natur
Sozial lebende Tiere bleiben länger zusammen als es für die reine Fortpflanzung – das Aufwachsen der Jungen – notwendig wäre. Viele dieser Tiergruppen haben eigene Namen: Bei Vögeln und Fischen ist es der Schwarm, Schafe und Kühe leben in der Herde, bei Gänsen ist es die Schar, Wölfe und Hunde leben im Rudel und bei Wildschweinen ist es die Rotte, ein Verband, der von erfahrenen Weibchen angeführt wird.
Es sind vor allem die sozial lebenden Tierarten, die vom Menschen domestiziert wurden, Hasen als Beispiel für nicht domestizierte Tiere sind Fluchttiere, die nicht in Verbänden leben, die über die reine Fortpflanzung hinausgehen.
Die Vorteile des Zusammenlebens liegen auf der Hand: Die Chance, gefressen zu werden, sinkt mit der Anzahl der Individuen, ein Fressfeind kann verwirrt werden, weil sich die Gruppe unerwartet bewegt oder aufteilt. Es kann auch selbst besser gejagt werden. Es gibt auch physikalische Vorteile, zum Beispiel beim Vogelflug, wenn die V-Formation den Luftwiderstand für alle, die nicht an der Spitze fliegen, verringert. Warum es aber Individuen gibt, die als “Leader” die Führung übernehmen, ist Gegenstand der Verhaltensforschung.
Gestaltung: Lothar Bodingbauer
Teil 1: 10.02.2025. Der Wildbiologe Klaus Hackländer spricht über die Gemeinschaft der Wildschweine. Filename: radio_395_gruppe_1
Teil 2: 11.02.2025. Der Imkermeister Marian Aschenbrenner erzählt von den Honigbienen. Filename: radio_395_gruppe_1
Teil 3: 12.02.2025. Die Biologin Didone Frigerio erzählt von Graugänsen in der Gruppe. Filename: radio_395_gruppe_3
Teil’ 4: 13.02.2025. Die Tiertrainerin Lina Oberließen über das Wolfsrudel. Filename: radio_395_gruppe_4
Teil 5: 14.02.2025. Der Verhaltensforscher und Biologe Kurt Kotrschal spricht über das artübergreifende Zusammenleben. Filename: radio_395_gruppe_5
Links:
1. Klaus Hackländer, Univ.Prof. Dipl.-Biol. Dr.rer.nat., Leiter vom Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft, Universität für Bodenkultur in Wien, https://boku.ac.at/personen/person/63763DC327656602
2. Marian Aschenbrenner, Gründer und Obmann des Vereins Bienenzentrum, http://www.biezen.at
3. Dr.in Didone Frigerio, Stv. Leiterin der Konrad Lorenz Forschungsstelle, https://klf.univie.ac.at/de/team/
4. Dr.in Lina Oberließen, Wissenschaftskoordinatorin vom Wolfforschungszentrum der Veterinärmedizinischen Universität Wien, https://www.wolfscience.at/de/unser-team/unsere-menschen/lina-oberliessen/
5. ao. Univ.-Prof. i.R. Mag. Dr. Kurt Kotrschal, https://ufind.univie.ac.at/de/person.html?id=2793

30. Jan 2025 | Physikalische Soiree, Podcastepisode
Christoph Hörweg, Leiter der 3. Zoologischen Abteilung / Kurator der Sammlung Arachnoidea / wissenschaftlicher Mitarbeiter (Naturhistorisches Museum Wien) im Gespräch mit Lothar Bodingbauer über die Spinne.
Hinweis: “Ins Netz gegangen”. Ausschnitte aus diesem Gespräch sind in der Sendung Diagonal, am 22. Februar 2025, ab 17 Uhr im ORF Österreich 1 Radioprogramm zu hören. Link zur Sendung
Buchtipp: Graham, Michael H.; Parker, Joan; Dayton, Paul K.. The Essential Naturalist: Timeless Readings in Natural History (English Edition), daraus der Text: Crompton, 1. 1954. The Life of Spiders. The New American Library of World Literature, New York; “The Wolf Spiders, “pp. 66-74.
Diese Episode ist am 30.01.2025 erschienen. Dauer: 0
Stunden
54
Minuten
und 54
Sekunden
Ähnliche Episoden:

27. Jan 2025 | Physikalische Soiree, Podcastepisode
Gespräch mit Lina Oberließen, Animal Trainer & Scientific Coordinator, Wolf Science Center (WSC), Ernstbrunn.
Themen: Blickkontakt mit einem Wolf, Mythos Alphawolf, Wolfs(Patchwork)familien, Trauerverhalten und Bindung sowie das Konzept der Selbsterkenntnis beim Wolf.
Vom Leben der Tiere in der Gruppe
Sozial lebende Tiere bleiben länger zusammen als es für die reine Fortpflanzung – das Aufwachsen der Jungen – notwendig wäre. Viele dieser Tiergruppen haben eigene Namen: Bei Vögeln und Fischen ist es der Schwarm, Schafe und Kühe leben in der Herde, bei Gänsen ist es die Schar, Wölfe und Hunde leben im Rudel und bei Wildschweinen ist es die Rotte, ein Verband, der von erfahrenen Weibchen angeführt wird.
Es sind vor allem die sozial lebenden Tierarten, die vom Menschen domestiziert wurden, Hasen als Beispiel für nicht domestizierte Tiere sind Fluchttiere, die nicht in Verbänden leben, die über die reine Fortpflanzung hinausgehen.
Die Vorteile des Zusammenlebens liegen auf der Hand: Die Chance, gefressen zu werden, sinkt mit der Anzahl der Individuen, ein Fressfeind kann verwirrt werden, weil sich die Gruppe unerwartet bewegt oder aufteilt. Es kann auch selbst besser gejagt werden. Es gibt auch physikalische Vorteile, zum Beispiel beim Vogelflug, wenn die V-Formation den Luftwiderstand für alle, die nicht an der Spitze fliegen, verringert. Warum es aber Individuen gibt, die als “Leader” die Führung übernehmen, ist Gegenstand der Verhaltensforschung.
Hinweis: Im ORF Radioprogramm Österreich 1 sind Ausschnitte aus diesem Podcast zu hören: 8:55 Uhr – 9:00 Uhr, und als Podcast https://sound.orf.at/podcast/oe1/oe1-vom-leben-der-natur
Diese Episode ist am 27.01.2025 erschienen. Dauer: 0
Stunden
20
Minuten
und 33
Sekunden

27. Jan 2025 | Physikalische Soiree, Podcastepisode
Stefan Graf ist Experte für Aquariengestaltung und Gründer von Liquid Nature (Wien. Er beschreibt im Gespräch mit Lothar Bodingbauer die vielseitigen Aspekte gestalteter Wasserlandschaften: Aquarien, Paludarien und Terrarien.
Link: https://www.liquidnature.at
Die technische Ausstattung spielt eine entscheidende Rolle bei der Stabilisierung dieser Lebensräume. Beleuchtungssysteme beeinflussen das Wachstum von Pflanzen und Algen, während CO2-Versorgung und Filtertechnik essenziell für das ökologische Gleichgewicht sind. Stefan erklärt, wie wichtig eine durchdachte Planung und die Wahl geeigneter Materialien sind, um langfristig stabile Bedingungen zu schaffen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Bedeutung des Bodengrunds, da dieser Nährstoffe speichert und zur Vermeidung von Algenbildung beiträgt.
Die biologische Dynamik solcher Systeme basiert auf dem Zusammenspiel von Pflanzen, Algen und Mikroorganismen. Stefan hebt hervor, dass Geduld ein entscheidender Faktor ist. Ein biologisches Gleichgewicht kann nur durch schrittweise Anpassungen und kontinuierliche Beobachtung erreicht werden. Fehler in der Anfangsphase, etwa durch zu frühe Besetzung mit Fischen oder eine Überdüngung, können das gesamte System destabilisieren. Daher ist es ratsam, den Einlaufprozess abzuwarten, bis sich ein stabiles Milieu etabliert hat.
Lothar Bodingbauer berichtet von seinen persönlichen Erfahrungen mit der Einrichtung eines Aquariums und den Herausforderungen, die mit der Haltung von Schnecken und Pflanzen verbunden sind. Anfänger bringen manchmal zu wenig Geduld auf, um die komplexen Wechselwirkungen in Aquarien zu verstehen. Regelmäßig auftretende Probleme, wie unerwartetes Algenwachstum oder unklare Wasserverhältnisse, lassen sich meist durch Anpassungen der Pflege und Nährstoffzufuhr lösen.
Ein zentraler Punkt ist die artgerechte Haltung von Tieren in Aquarien. Überbesetzung oder falsche Vergesellschaftung führt zu Stress und beeinträchtigt das Wohlbefinden der Tiere. Eine naturnahe Gestaltung berücksichtigt die den Bedürfnissen der jeweiligen Fischarten entspricht. Dazu gehören Rückzugsorte, ausreichend Strömung und die richtige Wasserzusammensetzung. Gerade bei heimischen Arten ist es wichtig, saisonale Schwankungen zu berücksichtigen, da sie sich an bestimmte Temperatur- und Lichtbedingungen angepasst haben.
Dann geht es auch um die Gestaltung, das “Aquascaping”, die Verbindung von Ästhetik und Funktionalität. Stefan erläutert verschiedene Stilrichtungen, die von japanischen Nature-Aquarien bis zu naturnahen Biotopen reichen. Die Wahl von Steinen, Holz und Pflanzen beeinflusst dann auch nicht nur das visuelle Erscheinungsbild, sondern auch das Verhalten der Tiere.
Die Verantwortung gegenüber den Tieren erfordert eine bewusste Auseinandersetzung mit ihren Bedürfnissen und Lebensbedingungen. Stefan warnt davor, Tiere aus der Natur zu entnehmen oder sie bei Überpopulation einfach auszusetzen. Alternativ können regulierte Futterzugaben oder der Einsatz natürlicher Fressfeinde zur Kontrolle der Population beitragen.
Viele Pflanzen, die im Handel erhältlich sind, sind eigentlich Sumpfpflanzen. Sie können sowohl unter als auch über Wasser wachsen. Die richtige Kombination von Licht, Nährstoffen und CO2 ist entscheidend für ein gesundes Pflanzenwachstum. Algenprobleme entstehen oft durch Ungleichgewichte, die durch gezielte Pflege und Kontrolle behoben werden können.
Die Langzeitpflege von Aquarien und Paludarien erfordert regelmäßige Wartung und Anpassungen. Stefan weist darauf hin, dass der Lebenszyklus eines Aquariums begrenzt ist. Mit der Zeit sammeln sich Nährstoffdepots und organische Ablagerungen im Bodengrund, die regelmäßig entfernt oder durch neue Substrate ersetzt werden müssen. Besonders bei größeren Becken ist es sinnvoll, modulare Strukturen zu verwenden, um schnell einmal bestimmte Teile auszutauschen.
Diese Episode ist am 27.01.2025 erschienen. Dauer: 1
Stunde
17
Minuten
und 3
Sekunden
27. Jan 2025 | ORF, Österreich 1, Premium, Radioproduktion, Vom Leben der Natur
Mikroorganismen sind Lebewesen, die mit bloßem Auge nicht erkennbar sind. Dazu zählen Einzeller, Bakterien und Archaeen, die zu den einfachsten Lebensformen gehören und früh in der Evolution entstanden sind. Diese Organismen sind weniger als ein Millionstel Meter groß und besitzen keinen Zellkern. Ihre Struktur besteht aus einer einfachen Zellhülle, die alle lebensnotwendigen Komponenten enthält.
Nach heutigem Verständnis entstanden Archaeen gleichzeitig mit Bakterien, vermutlich früh nach der Entstehung der Erde. Sie kommen in extremen Lebensräumen vor, wie etwa in heißen Quellen, stark salzhaltigen Umgebungen oder an Orten mit hohem Druck. Ihre Überlebensstrategien und Anpassungsmechanismen sind Gegenstand wissenschaftlicher Forschung. Ziel ist, ihre Funktionsweise zu verstehen und mögliche Anwendungen, etwa in der Biotechnologie, zu identifizieren.
Thermophile Mikroorganismen leben in Umgebungen mit sehr hohen Temperaturen, wie etwa in heißen Quellen oder hydrothermalen Tiefseequellen. Diese Organismen haben hitzebeständige Enzyme entwickelt, die auch bei Temperaturen von über 100 Grad Celsius funktionsfähig bleiben. Halophile Mikroorganismen wiederum hingegen kommen in stark salzhaltigen Umgebungen vor. Auch sie haben evolutionäre Mechanismen zur Anpassung entwickelt.
Die extremophilen Lebensformen erlauben, Erkenntnisse für die Grundlagenforschung und für praktische Anwendungen zu gewinnen, sie ermöglichen Aufschlüsse auf die ersten Lebensformen, die vor mehr als zwei Milliarden Jahren auf der Erde entstanden sind.
Gestaltung: Lothar Bodingbauer
Sendung: 27.01.2025 – 31.01.2025 Österreich 1 Radio / 08:55 Uhr – 09:00 Uhr
Service
Gesprächspartnerin:
Univ.-Prof.in Dr.in Christa Schleper
Department für Funktionelle und Evolutionäre Ökologie
Leiterin der Arbeitsgruppe Archaea-Ökologie und Evolution
Universität Wien
1030 Wien, Djerassiplatz 1
https://archaea.univie.ac.at/team/schleper/
Teil 1: Die Grenze des Möglichen. Filename: radio_394_archaeen_1
Teil 2: Kochende Tümpel. Filename: radio_394_archaeen_2
Teil 3: Salziges Wasser. Filename: radio_394_archaeen_3
Teil 4: Die Gründe zum Überleben. Filename: radio_394_archaeen_4
Teil 5: Kontrollierte Bedingungen – Besuch im Labor. Filename: radio_394_archaeen_5
Link zur Sendung: https://oe1.orf.at/programm/20250127/782770/Archaeen-1
13. Jan 2025 | ORF, Österreich 1, Premium, Radioproduktion, Vom Leben der Natur
Der Genetiker Manfred Schartl vom Forschungsinstitut für Limnologie in Mondsee spricht über den Lungenfisch.
13. –17. Jänner 2025, 08:55 Uhr
Lungenfische sind eine sehr alte Gruppe von Fischen, die sowohl im Wasser als auch an Land leben können. Sie verfügen über eine Lunge, ein Merkmal, das bei den meisten anderen Fischen nicht vorkommt. Diese Lunge hat sich unabhängig von den Kiemen entwickelt und stammt entwicklungsgeschichtlich von der Schwimmblase ab. Sie ermöglicht das Atmen in sauerstoffarmen Gewässern und sogar an Land.
Lungenfische sind auf drei Kontinenten verbreitet: Australien, Afrika und Südamerika. Die heute noch existierenden Arten gehören zu drei Hauptlinien, die sich vor etwa 300 bis 400 Millionen Jahren während der Kontinentaldrift des ehemaligen Gondwanalands voneinander trennten. Historisch gab es eine Vielzahl von Lungenfischarten, die meisten sind jedoch ausgestorben.
Die heute afrikanischen und südamerikanischen Arten können Trockenzeiten überstehen, indem sie sich in den Schlamm eingraben und eine schützende Hülle bilden, bis Regen wieder Wasserlebensräume schafft.
Ein weiteres bedeutendes Merkmal der Lungenfische sind ihre Flossen, die Ähnlichkeiten mit den Vorläufern von Gliedmaßen der Landwirbeltiere aufweisen. Das macht sie zu einem bedeutenden Studienobjekt in der Evolutionsbiologie. Lungenfische gelten sie als die nächsten lebenden Verwandten der Landwirbeltiere.
Gestaltung: Lothar Bodingbauer
Service
Gesprächspartner:
Prof. Dr. Manfred Schartl
Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee
Universität Innsbruck
Mondseestrasse 9
A-5310 Mondsee
Teil 1: Heimisch auf drei Kontinenten. Filename: radio_393_lungenfisch_1
Teil 2: Die gesamte Erbinformation im größten Genom aller Tiere. Filename: radio_393_lungenfisch_2
Teil 3: Sprunghafte Gene. Filename: radio_393_lungenfisch_3
Teil 4: Unsere Vorfahren im Wasser. Filename: radio_393_lungenfisch_4
Teil 5: Der Pfad zur High-End Forschung. Filename: radio_393_lungenfisch_5