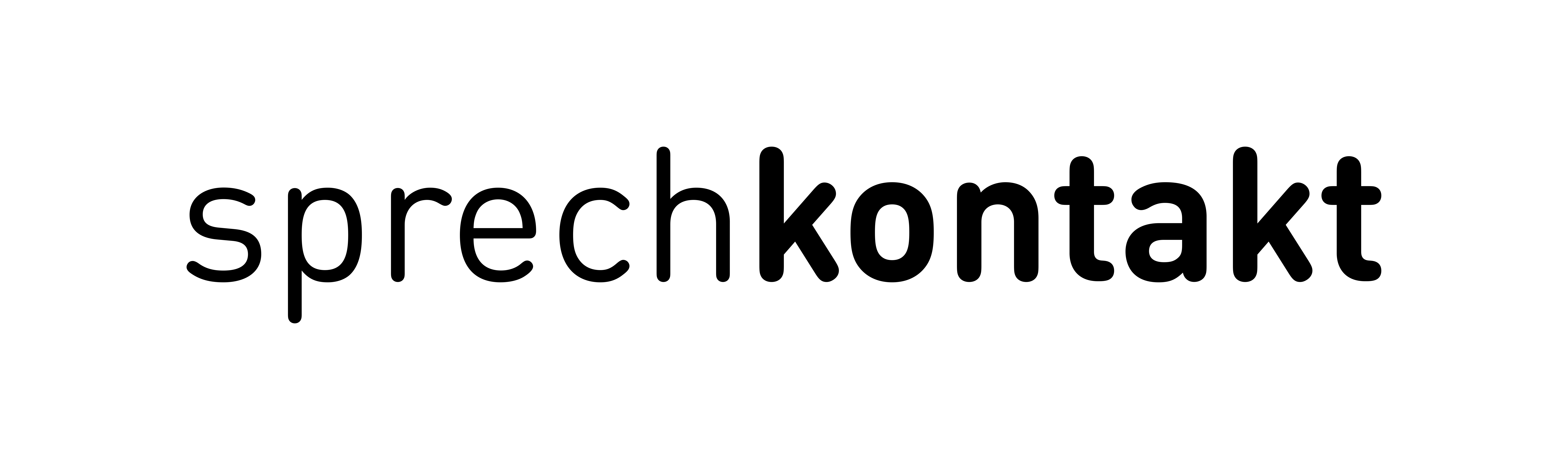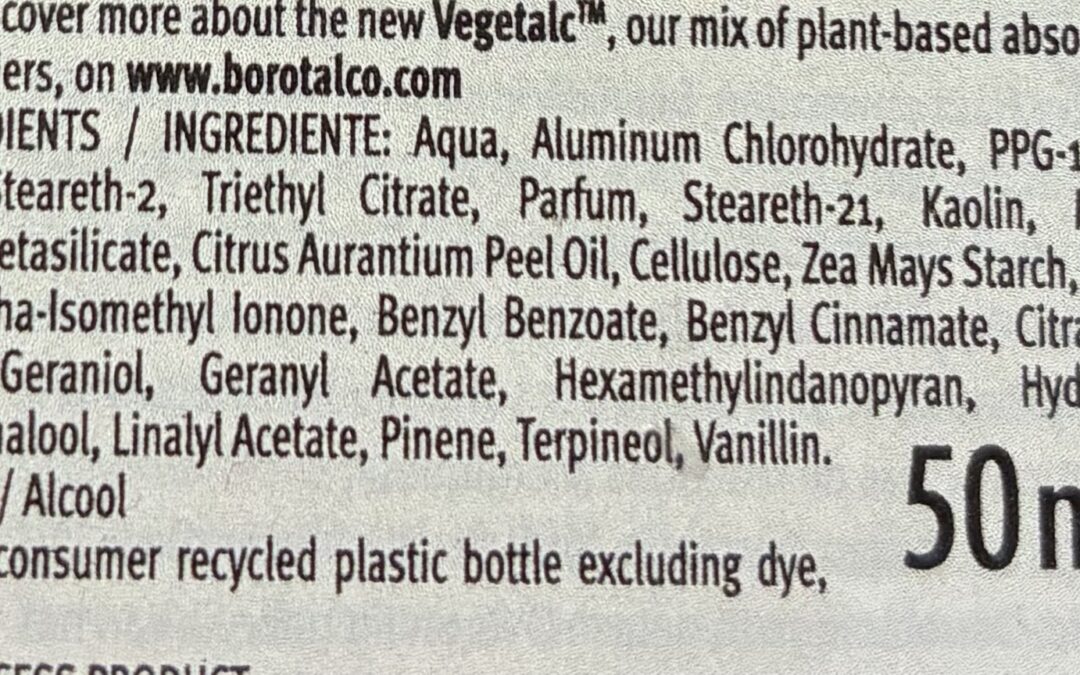11. Jan 2026 | Österreich 1, Radioproduktion, Vom Leben der Natur
Link: https://oe1.orf.at/programm/20260112#819338/Grenzen-in-der-Unendlichkeit
Die Astronomin Ruth Grützbauch spricht über die Lichtgeschwindigkeit im Weltall, die wie ein Faden zwischen Raum und Zeit wirkt, das Ende des Beobachtbaren im Weltall, den Anfang des Universums, die Besonderheiten der Naturkonstanten, die Zeit, und was passiert, wenn ein Stern endet.
Eine Schwelle im Universum stellt ein Gleichgewicht dar. Wenn zum Beispiel der Einfluss der Sonne mit dem Einfluss des interstellaren Raums im Gleichgewicht steht – also dort, wo sich die Teilchendichten angleichen – dann spricht man von einer Übergangszone. Dort befindet sich die Grenze unseres Sonnensystems. Genau genommen handelt es sich aber eher um eine Schwelle: Denn es geht weiter, bis man irgendwann, in etwa 4,2 bis 4,5 Lichtjahren Entfernung, beim nächsten Stern ankommt – bei Proxima Centauri.
Eine klare Grenze hingegen ist die Lichtgeschwindigkeit. Nichts kann sich schneller als das Licht im Vakuum ausbreiten – weder Materie noch Information. Diese Grenze ist unabhängig vom Beobachter und stellt eine fundamentale Schranke in unserem Universum dar.
Warum das so ist, möchte die Astronomie nur ungern beantworten, auch wenn die Frage nach dem “Warum” häufig gestellt wird. Beobachtungen werden in Modelle übersetzt, die beschreiben, wie sich Naturphänomene verhalten. Diese Modelle können das “Warum” manchmal andeuten, liefern aber vor allem überprüfbare Aussagen über das “Wie”.
Wer beim Blick ins Große dann ins Kleine schaut, kommt am Ende eines Sternes nicht vorbei. Am Ende der Lebenszeit eines Sterns halten sich Strahlungsdruck und Gravitationskraft nicht mehr die Waage: Der nukleare Brennstoff ist aufgebraucht, und die Gravitation gewinnt die Oberhand. Der Stern kollabiert. Je nach Masse endet dieser Prozess als Weißer Zwerg oder – bei besonders großer Masse – als Schwarzes Loch. Der sogenannte Schwarzschildradius bezeichnet dann jene Grenze um ein Schwarzes Loch, ab der nichts mehr entkommen kann, nicht einmal Licht. Jenseits dieses Punktes verlieren unsere bekannten physikalischen Beschreibungen ihre Gültigkeit – zumindest nach heutigem Kenntnisstand.
Gestaltung: Lothar Bodingbauer
Service
Gesprächspartnerin:
Dr.in Ruth Grützbauch
Astronomin und Wissenschaftsvermittlerin
Initiatorin und Leiterin des Projekts “Public Space/Pop-Up-Planetarium”
Das mobile Planetarium

1. Dec 2025 | ORF, Österreich 1, Radioproduktion, Vom Leben der Natur
Der Teilchenphysiker Emmerich Kneringer spricht über die Bedeutung der Höhenstrahlung für die Wissenschaft. – Am Innsbrucker Hafelekar befindet sich auf rund 2.300 m Seehöhe ein historisches Observatorium für die sogenannte Höhenstrahlung: die Victor-Franz-Hess-Messstation. Die Höhe ist bedeutsam, weil man ursprünglich glaubte, dass der Ursprung der gemessenen Strahlung am Boden liege – also in radioaktiven Elementen im Erdreich – die mit steigender Höhe abnehmen müsste. Das Gegenteil war der Fall. Der österreichische Physiker Victor Franz Hess erforschte die Strahlung mit einem Ballon und erkannte, dass die Herkunft der Strahlung außerhalb der Erde liegt. In Innsbruck wurde ein Observatorium errichtet, um diese Strahlung zu messen. Für die Entdeckung der sogenannten Höhenstrahlung erhielt Hess im Jahr 1936 gemeinsam mit Carl David Anderson – dem Entdecker des Positrons – den Nobelpreis für Physik für jene Arbeiten, die 1912 in Wien zur Entdeckung der kosmischen Strahlung geführt hatten. Victor Franz Hess musste danach in die USA emigrieren, weil er den Nationalsozialismus nicht unterstützte. Heute ist das Victor-Franz-Hess-Observatorium ein Museum, das auch von Touristinnen und Touristen besucht werden kann.
(more…)
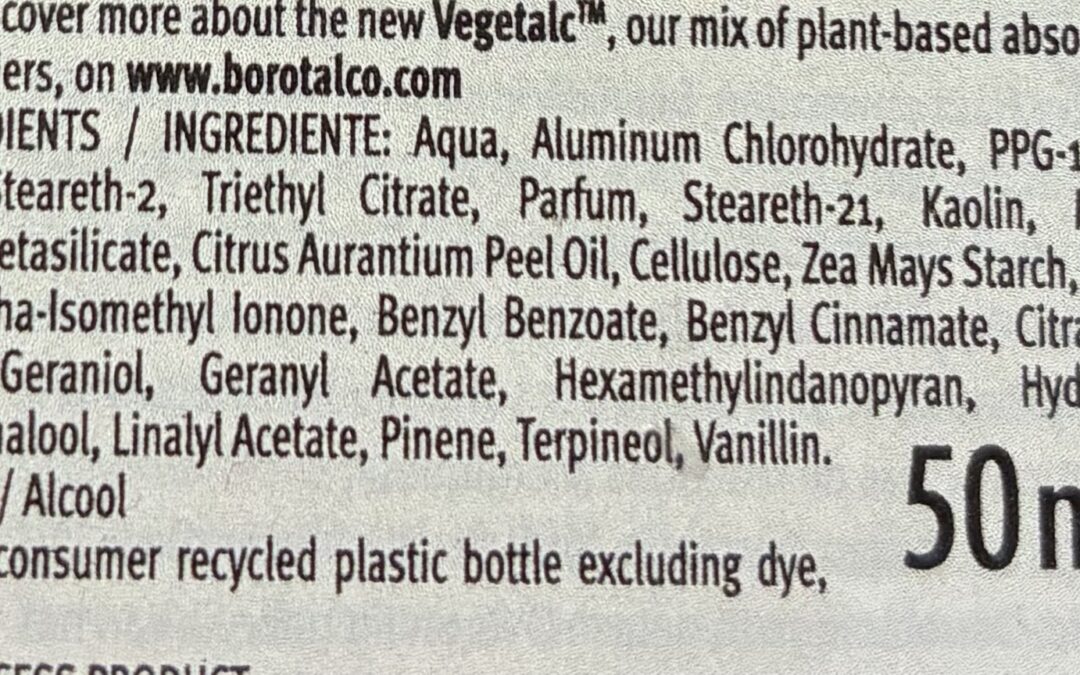
27. Nov 2025 | Dimensionen (Open Space), ORF, Österreich 1, Radioproduktion
Zu Gast im OPEN SPACE am Donnerstag: der Biochemiker Michael Zumstein. – Sie stecken in Wasch- und Reinigungsmitteln, in Duschgels und Haarshampoos oder in Farben und Lacken: wasserlösliche Polymere. Weltweit werden davon 1 Million Tonnen pro Jahr produziert. Nach der Anwendung dieser Produkte gelangen die enthaltenen wasserlöslichen Polymere ins Abwasser, was deren Wiederverwertung verhindert. Umso wichtiger ist die Erforschung der chemischen und mikrobilogischen Prozesse. Genau das findet am neu gegründeten “Christian Doppler Labor für Biologischen Abbau von Wasserlöslichen Polymeren am Zentrum für Mikrobiologie und Umweltsystemwissenschaften” der Universität Wien statt. Dessen Leiter, der Biochemiker Michael Zumstein, spricht über seine Forschungsarbeit.

10. Nov 2025 | ORF, Österreich 1, Radioproduktion, Vom Leben der Natur
Die Wiederansiedelung gefährdeter Pflanzen in Österreich.
- Die Talprachtnelke (Kärnten)
- Schachblume und Steinbrech (Wien)
- Ackerwildkräuter (Wien)
- Der Lungenenzian (Salzburg)
- Alpenkräuter (Tirol)
Die “Rote Liste gefährdeter Pflanzen, Moose, Algen” weist in Österreich 1.274 Arten auf: 66 Arten sind österreichweit ausgestorben bzw. verschollen, 235 Arten sind vom Aussterben bedroht, dazu kommen weitere 973 Arten, die in geringerem oder auch in unbekanntem Ausmaß gefährdet sind.
Die Botanischen Gärten der Bundesländer spielen derzeit eine besondere Rolle im Schutz dieser Pflanzen. Sie vermehren rund 50 der gefährdeten Arten an ihren Standorten, um sie anschließend wieder auf geeigneten Flächen anzusiedeln.
Die Botanischen Gärten greifen dabei auf das Wissen ihrer Gärtner:innen zurück, wie Pflanzen aus genehmigten Wildsammlungen aufzuziehen sind, damit sie zum passenden Zeitpunkt in möglichst großer Menge zur Verfügung stehen. Die Wissenschaftler:innen der beteiligten Einrichtungen sind Spezialist:innen in ihren Bundesländern – weit weg sollen die Pflanzen nämlich nicht von ihren ursprünglichen Standorten umziehen müssen. Es gilt die genetischen Eigenheiten der Pflanzen einer Region zu bewahren, und gleichzeitig bei der Wiederansiedlung weit genug von bedrohten Flächen abzurücken.
Ackerwildkräuter etwa haben als Kulturfolger den Acker für sich entdeckt; auch Wiesen, Hänge und Sümpfe weisen besondere Bedingungen für viele Pflanzenarten auf, die es zu verstehen gilt.
Das Projekt wird vom Biodiversitätsfonds und dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft und NextGenerationEU gefördert.
Link: Projekt Gefährdete Pflanzenarten Österreichs
(more…)
30. Oct 2025 | Dimensionen, ORF, Österreich 1, Radioproduktion
60 Jahre Volksmusikforschung in Wien: Im Oktober 2025 feiert das Institut für Volksmusikforschung und Ethnomusikologie der Universität für Musik und Darstellende Kunst feiert 60 Jahre Forschung, künstlerische Praxis, Lehre und gesellschaftspolitisches Engagement. Die Beschäftigung mit der Bedeutung von Volksmusik hat es auch schon vorher gegeben, als Institut war es ab 1965 möglich, Teil einer internationalen Forschungslandschaft zu werden, die sich mit den musikalischen Traditionen von Menschen, die gemeinsam Musik abseits der Konzertsäle machen, beschäftigt. Neben der Musik selbst ist immer auch das Soziale bedeutsam: wie leben Menschen in Minderheiten, in Mehrheiten, in Fluchtumständen miteinander, und wie wirkt sich das auf ihre Musik aus. Ein Gespräch mit Institutsleiter Marko Kölbl. (Lothar Bodingbauer)

23. Oct 2025 | Dimensionen, ORF, Österreich 1, Radioproduktion
Waldökologie: Fast die Hälfte Österreichs ist von Wald bedeckt – nicht unbedingt, weil das immer schon so geplant war, sondern weil große Teile des Waldes in schwer zugänglichem Gelände liegen und nicht aktiv genutzt werden können. Große Teile der Waldfläche gelten auch als Schutzwald. Wer sich mit Waldökologie beschäftigt, versucht, die Lebensräume und ihre Umweltfaktoren zu verstehen und sie mit den Lebewesen des Waldes in Verbindung zu bringen. Wir sprechen von „Ökosystemleistungen“, wenn es darum geht, den Wert des Waldes für eine Gesellschaft zu quantifizieren. Der Wald weckt auch Emotionen. Lothar Bodingbauer spricht mit Mario Pesendorfer, der am Institut für Waldökologie der Universität für Bodenkultur in Wien zu Semesterbeginn – nach langer Zeit der Forschungsarbeiten in den USA – in Österreich als neu berufener Professor seine Antrittsvorlesung gehalten hat.
9. Oct 2025 | Diagonal, ORF, Radioproduktion
Quantenphysik vermitteln: Die UNESCO hat das Jahr 2025 zum „Internationalen Jahr der Quantenwissenschaft und Quantentechnologien“ ausgerufen. 57 Länder beteiligen sich an diesem Quantenjahr. Vom 6. bis 10. Oktober 2025 haben Schulen in Innsbruck, Linz, Wien und deren näheren Umgebung die Möglichkeit, Workshops teilzunehmen. Im Mittelpunkt steht eine interaktive Escape Challenge, die Quantenphänomene spielerisch vermittelt – und zwar direkt im Klassenzimmer. Lothar Bodingbauer spricht mit den Organisatorinnen, den Innsbrucker Quantenphysikerinnen Lea Trenkwalder und Andrea López-Incera.

15. Sep 2025 | Dimensionen, ORF, Österreich 1, Radioproduktion
Fensterglas ist echt das schrägste Material. Licht soll durch, der Rest (Staub, Lärm, Wärme) nicht. Das Bild soll nicht verzerrt werden, wenn man hinaus- oder hineinschaut. Die Farben sollen gleich bleiben. Und sicher soll es sein. Die Römer haben die ersten Fenstergläser hergestellt, in europäischen Klöstern wurden für Kirchenfenster flache Stellen aus Glasblasen verwendet, im 17. Jahrhundert wurden in Venedig und später in England das “Crown-Glass-Verfahren” und das “Cylinder-Glass-Verfahren” entwickelt, ab dem 19. Jahrhundert wurde weltweit gewalzt. Bis hierher waren die Gläser oft uneben und trüb. 1959 wurde in den USA (Pilkington, UK) das Floatglasverfahren erfunden, das modernes, klares Fensterglas ermöglicht. Die Eigenschaften sind exakt gestaltbar: Wärmeleitfähigkeit, Schalldämmung, Lichttransmission, Elastizität, Biegezugfestigkeit, Splitterverhalten – und Größe. (Lothar Bodingbauer)

15. Sep 2025 | Dimensionen, ORF, Österreich 1, Radioproduktion
Ein Gespräch mit Günter Blöschl vom Institut für Wasserbau und Ingenieurhydrologie der TU Wien
Die Schwedische Akademie der Wissenschaften vergibt nicht nur die Nobelpreise für Medizin, Physik, Chemie und Wirtschaft, sondern auch den “Stockholm Water Prize”. Heuer ging er an den Österreicher Günter Blöschl von der TU Wien. Im “Open Space” der Dimensionen am Donnerstag spricht Blöschl über seine frühe Faszination für das Wasser, die Wiener Schule der Hydrologie und den Hochwasserschutz, der in Zeiten des Klimawandels immer wichtiger wird.
Link zur Sendung: https://oe1.orf.at/programm/20250904#806733/Der-Wassernobelpreistraeger (ORF Österreich 1, Dimensionen, 04.09.2025)
15. Sep 2025 | Dimensionen, ORF, Österreich 1, Radioproduktion
Die Eroberung von Gebieten nördlich der Alpen durch das antike Rom wurde maßgeblich von Pferden und Maultieren geprägt, die die Römer selbst mitgebracht haben. Lokale keltische Rassen waren zu klein, um für Militär und Transport nützlich zu sein. Das hat eine internationale Forschungsgruppe um Elmira Mohandesan vom Konrad-Lorenz-Institut für Vergleichende Verhaltensforschung der Veterinärmedizinischen Universität Wien herausgefunden. Die Studie basiert auf einer genetischen Spurensuche in rund 400 archäologischen Funden. Sie zeigt, wie sehr das Leben der Menschen dieser Gegend von Pferden und Maultieren – von Equiden – geprägt wurde. Ein Beitrag von Lothar Bodingbauer.
Interviewpartnerin: Elmira Mohandesan, Universität Wien
Sendung: ORF Radio Österreich 1, Dimensionen